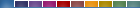Vergabepraxis & -recht.
Volltexturteile nach Sachgebieten
5471 Entscheidungen insgesamt
Online seit 2004
VPRRS 2004, 0535 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Baden-Württemberg, Beschluss vom 21.11.2001 - 1 VK 37/01
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0534
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Baden-Württemberg, Beschluss vom 21.09.2001 - 1 VK 28/01
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0533
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Baden-Württemberg, Beschluss vom 09.10.2001 - 1 VK 27/01
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0532
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Baden-Württemberg, Beschluss vom 20.09.2001 - 1 VK 26/01
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0531
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Baden-Württemberg, Beschluss vom 14.09.2001 - 1 VK 24/01
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0530
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Baden-Württemberg, Beschluss vom 12.02.2002 - 1 VK 02/02
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0529
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Baden-Württemberg, Beschluss vom 12.02.2002 - 1 VK 48/01
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0528
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
BayObLG, Beschluss vom 29.10.2004 - Verg 22/04
1. Zur Auftraggebereigenschaft eines privatrechtlichen Vereins, der im Rahmen eines Mietmodells mit Kaufoption eine staatlich anerkannte private Berufsschule errichtet. *)
2. Die Identität der ausgeschriebenen mit der angebotenen Leistung ist auch im Verhandlungsverfahren nicht mehr gewahrt, wenn der Bieter für die maßgeblichen Leistungen nicht selbst Vertragspartner, sondern nur deren Vermittler sein will. *)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0527
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Baden-Württemberg, Beschluss vom 21.02.2002 - 1 VK 52/01
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0526
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Baden-Württemberg, Beschluss vom 20.03.2002 - 1 VK 04/02
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0525
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Brandenburg, Beschluss vom 29.11.2001 - 2 VK 44/00
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0524
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Lüneburg, Beschluss vom 12.11.2001 - 203-VgK-19/2001
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0523
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Schleswig-Holstein, Beschluss vom 12.11.2004 - VK-SH 30/04
1. Zum Zwecke der Vergleichbarkeit der Angebote hat der Auftraggeber bei der Vergabe von Ingenieurleistungen nicht nur alle Auftragskriterien anzugeben (§ 16 Abs. 3 VOF), sondern auch die Leistungen der Bauüberwachung (§ 57 HOAI) und der Bauoberleitung (§ 55 LP 8 HOAI) in der Leistungsbeschreibung gesondert zu spezifizieren sowie die Methode für die Honorarermittlung nach § 57 Abs. 2 HOAI (Berechnungsmethode oder Festbetrag) vorzugeben.*)
2. Die mögliche Vorbefasstheit eines Bieters i.S.v. § 4 Abs. 2 und 3 VOF ist im Einzelfall zu prüfen.*)
3. Eignungskriterien i.S.v. § 10 bis 13 VOF können keine Auswahlkriterien i.S.v. § 16 Abs. 2 und 3 VOF sein.*)
4. Die Vergabekammer hat bei ihren Entscheidungen nach § 114 Abs. 1 GWB den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten.*)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0522
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Lüneburg, Beschluss vom 07.12.2001 - 203-VgK-20/2001
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0521
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Lüneburg, Beschluss vom 28.11.2001 - 203-VgK-21/2001
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0520
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Lüneburg, Beschluss vom 14.01.2002 - 203-VgK-22/2001
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0519
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Sachsen, Beschluss vom 29.10.2004 - 1/SVK/101-04
1. Ein Angebot ist zwingend auszuschließen, wenn in ihm obligatorisch abzugebende Erklärungen fehlen, bei denen es sich um unverzichtbare Grundlagen des Angebots handelt. Diese können z.B. der lückenlosen Nachweis einer vorschriftsmäßigen Entsorgung (z.B. Eignungsnachweis des Herstellers für Arbeitsschutzmittel, die Zulassungen für die Verpackungsmittel und Annahmeerklärungen der Entsorger der Holzabfälle, des Stahlschrotts und der Transformatoren) sein oder die qualifizierten Eignungsnachweise.
2. Eine Rüge erst im Antwortschreiben auf das Absageschreiben nach § 13 VgV ist nicht mehr unverzüglich.
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0517
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Lüneburg, Beschluss vom 11.06.2001 - 203-VgK-08/2001
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0516
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Lüneburg, Beschluss vom 19.06.2001 - 203-VgK-12/2001
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0515
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Köln, Beschluss vom 22.06.2004 - VK VOB 14/2004
Nebenangebote und Änderungsvorschläge dürfen bei der Vergabe nur gewertet werden, wenn der Auftraggeber in den Verdingungsunterlagen die Mindestanforderungen näher bezeichnet, welche Änderungsvorschläge und Nebenangebote erfüllen müssen.
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0514
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Mecklenburg-Vorpommern, Beschluss vom 13.10.2004 - 2 VK 13/04
Unterkostenangebote sind infolge offenbaren Missverhältnisses des Preises zur Leistung nur dann auszuschließen, wenn es entweder der gezielten und vollständigen Verdrängung anderer Bieter vom Markt dient oder wenn es den Bieter im konkreten Fall so in Schwierigkeiten bringt, dass er den Auftrag nicht ordnungsgemäß ausführen kann.
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0508
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Lüneburg, Beschluss vom 28.08.2001 - 203-VgK-17/2001
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0507
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Lüneburg, Beschluss vom 09.05.2001 - 203-VgK-04/2001
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0506
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Lüneburg, Beschluss vom 17.09.2001 - 203-VgK-18/2001
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0503
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Brandenburg, Beschluss vom 20.08.2001 - 2 VK 80/01
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0498
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Brandenburg, Beschluss vom 27.05.2002 - 2 VK 94/01
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0497
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Münster, Beschluss vom 15.10.2004 - VK 28/04
Die Vergabestelle muss unvollständige Angebote ausschließen.*)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0492
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Baden-Württemberg, Beschluss vom 27.09.2004 - 1 VK 66/04
1. Die Tatsache, dass das preisgünstigste Angebot wegen Unvollständigkeit auszuschließen ist, stellt keinen schwerwiegenden Grund i.S.d. § 26 VOB/A dar, der zur Aufhebung der Ausschreibung berechtigen würde, sofern weitere wertbare Angebote vorliegen.
2. In einem solchen Fall ist vielmehr das begonnene Verfahren mit den abgegebenen, wertbaren Angeboten fortzuführen.
3. Insbesondere ist eine Aufhebung missbräuchlich und damit unzulässig, wenn sie erklärtermaßen allein zu dem Zweck erfolgt, den Auftrag nicht an den zweitgünstigsten Bieter erteilen zu müssen, sondern ihn freihändig an eben den Bieter zu erteilen, dessen Angebot auszuschließen war.
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0491
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Hessen, Beschluss vom 25.08.2004 - 69d-VK-52/2004
Bieter mit einem Eigenleistungsanteil in Höhe von 18,52 % sind als Generalübernehmer zu qualifizieren. Solche Bieter können – zumindest bei Vergabeverfahren, mit dem Abschnitt 2 der VOB/A unterfallen – zwar deshalb nicht ausgeschlossen werden, müssen aber mit der Angebotsabgabe von sich aus zur Erfüllung ihrer Obliegenheitsverpflichtung den Nachweis über die Verfügbarkeit über die durch sie benannten Subunternehmer führen. Eine nachträgliche Nachweiserbringung ist ausgeschlossen (§ 24 VOB/A).*)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0487
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Thüringen, Beschluss vom 27.10.2004 - 360-4002.20-016/04-SON
Fehlen bei einem Angebot geforderte gerichtliche und amtliche Bestätigungen sowohl zur Tatsache des Nichtbestehens eines Liquidationsverfahrens, als auch das Fehlen eines Bundeszentralregisterauszuges selbst, ist das Angebot zwingend auszuschließen.
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0486
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Thüringen, Beschluss vom 01.11.2004 - 360-4002.20-033/04-MGN
1. Fehlen Festlegungen zu den für Nebenangebote geltenden Kriterien, ist es der Vergabestelle untersagt, die Nebenangebote in die Wertung einzubeziehen.
2. Die Beifügung einer eigenen Tariftreueerklärung führt zwingend zum Ausschluss des Angebots.
3. Es ist einer Holding gestattet Leistungsteile von Tochterunternehmen anzubieten, auf die sie nach entsprechender konzernrechtlicher Verflechtung jederzeit zugreifen kann. Im umgekehrten Fall gilt dieses nicht ohne Einschränkung, da eine Tochter, also ein konzernrechtlich nachgeordnetes Unternehmen ein übergeordnetes Unternehmen nicht zur Leistung verpflichten kann.
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0485
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Lüneburg, Beschluss vom 12.10.2004 - 203-VgK-45/2004
1. Die Rügepflicht des § 107 Abs. 3 Satz 1 GWB entsteht, sobald ein Bieter oder Bewerber im Vergabeverfahren einen vermeintlichen Fehler erkennt. Vorausgesetzt ist die positive Kenntnis des Anbieters von den Tatsachen. Ausreichend für diese positive Kenntnis im Sinne des § 107 Abs. 3 Satz 1 GWB ist bereits das Wissen um einen Sachverhalt, der den Schluss auf die Verletzung vergaberechtlicher Bestimmungen erlaubt und es bei vernünftiger Betrachtung gerechtfertigt erscheinen lässt, das Vergabeverfahren als fehlerhaft zu beanstanden.
2. Die Frage, ob eine Rüge noch unverzüglich nach positiver Kenntniserlangung erfolgt, hängt vom Einzelfall ab. Nach der Rechtsprechung muss die Rüge angesichts der kurzen Fristen, die im Vergaberecht allgemein gelten, grundsätzlich binnen 1 - 3 Tagen erfolgen. Eine Rügefrist von zwei Wochen, die in der Rechtsprechung als Obergrenze anerkannt wird, kann einem Bieterunternehmen allenfalls dann zugestanden werden, wenn eine verständliche Abfassung der Rüge durch eine schwierige Sach- und/oder Rechtslage erschwert wird und die Inanspruchnahme fachkundiger Hilfe erfordert.
3. Soll der Zuschlag auf das wirtschaftlich günstigste Angebot erfolgen, sind in den Verdingungsunterlagen oder der Bekanntmachung die Kriterien anzugeben, nach denen sich das wirtschaftlichste Angebot bemessen soll. Aus Gründen der Rechtsstaatlichkeit, Vorhersehbarkeit und Transparenz des Vergabeverfahren dürfen bei der Wertung von Angeboten nur Zuschlagskriterien zur Anwendung kommen, die zuvor in der Vergabebekanntmachung oder in den Verdingungsunterlagen bekannt gemacht worden sind, damit sich die interessierten Bieter darauf einstellen können.
4. In den Fällen, in denen der öffentliche Auftraggeber die Zuschlagskriterien nicht bekannt gemacht hat, darf nur der niedrigste Preis als Zuschlagskriterium angewendet werden.
5. Wird in der Leistungsbeschreibung der Einsatz von fabrikneuem Material vorgeschrieben, so ist ein Nebenangebot, welches die Verwendung bereits gebrauchter Materialien vorsieht, als nicht gleichwertig auszuschließen.
6. Wird in einem Vergabenachprüfungsverfahren von keinem der Bieter gerügt, dass ein eigentlich durchzuführendes Offenes Verfahren unterblieben ist, so ist die Vergabekammer gleichwohl nicht daran gehindert, dies im Rahmen ihrer Entscheidung zu berücksichtigen, sofern der Verstoß offensichtlich und evident ist.
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0484
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Sachsen, Beschluss vom 07.05.2002 - 1/SVK/035-02
. Die Angebotsbedingungen (Formular EVM (B) Ang) gehören nicht zu den Verdingungsunterlagen, sondern zu den Vergabeunterlagen. Änderungen an diesen ziehen nicht den zwingenden Ausschluss des Bieters gem. § 25 Nr. 1 Abs. 1 b i.V.m. § 21 Nr. 2 VOB/A nach sich. Der Auftraggeber im Rahmen seines Ermessens entscheidet, ob er das Angebot auch mit den vorgenommenen Änderungen werten kann.*)
2. Für Erklärungen des Bieters ist nicht das von ihm selbst verfasste Angebotsanschreiben, sondern das vom Auftraggeber verfasste Formblatt maßgeblich. Dies gilt auch für Nachlässe auf Nebenangebote. Sind diese nicht gem. § 25 Nr. 5 der VOB/A in der ab 2000 geltenden Fassung an der dafür vorgesehenen Stelle eingetragen, sind sie nicht zu werten.*)
3. Eine trotzdem erfolgte Aufklärung seitens des Auftraggebers stellt eine unzulässige Nachverhandlung dar. Diese muss aber im vorliegenden Fall nicht zwingend zu einem Ausschluss des Bieters führen, da sich die Bieterreihenfolge hierdurch nicht geändert hätte. Der Auftraggeber ist jedoch verpflichtet, das Angebot ohne den fraglichen Nachlass auf die gewerteten Nebenangebote zu werten.*)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0483
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Sachsen, Beschluss vom 05.11.2002 - 1/SVK/096-02
1. Die Einbeziehung eines Nebenangebotes in die Wertung nach § 25 Nr. 5 VOB/A setzt u.a. voraus, dass die Alternative objektiv gleichwertig ist. Dabei geht es entscheidend um die Frage, ob das Nebenangebot, so wie es vorliegt, mit hinreichender Sicherheit geeignet ist, dem Willen des Auftraggebers in allen technischen und wirtschaftlichen Einzelheiten gerecht zu werden. Nebenangebote müssen von vornherein so gestaltet sein, dass der Auftraggeber in der Lage ist, diese zu prüfen und zu werten. Die vorzulegenden Nachweise müssen es dem Auftraggeber ermöglichen, ohne weitere Untersuchungen die Gleichwertigkeit des Nebenangebots zu erkennen. Defizite des Bieters hinsichtlich der vorzulegenden Unterlagen muss der Auftraggeber nicht durch eigene, ergänzende Untersuchungen ausgleichen. Fehlt eine vollständige, übersichtliche und nachvollziehbare Präsentation der Gleichwertigkeit des Nebenangebotes oder ist diese lediglich allgemein gehalten, ist das Nebenangebot nicht zu berücksichtigen.*)
2. Ist die Durchführung der geplanten Maßnahme in der veränderten Technologie des Nebenangebotes noch von der Herstellung statischer Konzepte oder Bauausführungsplänen abhängig, macht deren Fehlen bei Angebotsabgabe das Nebenangebot unvollständig und damit nicht wertbar.*)
3. Bei § 30 VOB/A handelt es sich um eine bieterschützende Norm. § 30 VOB/A verpflichtet den Auftraggeber die gesamte Vergabeentscheidung (u. a. auch die Bewertung der Nebenangebote) im Vergabevermerk transparent und nachvollziehbar zu dokumentieren; dies gilt insbesondere, wenn er sich bei seiner Auswahlentscheidung über vorhandene gutachterliche Bewertungen hinwegsetzt.*)
4. Ein Verstoß gegen § 13 S.1 VgV liegt nicht vor, wenn der Auftraggeber den Bietern keine Informationen über die Annahme bzw. Ablehnung der Nebenangebote konkurrierender Bieter gibt.*)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0482
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Lüneburg, Beschluss vom 13.05.2002 - 203-VgK-07/2002
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0481
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Lüneburg, Beschluss vom 22.05.2002 - 203-VgK-08/2002
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0478
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Lüneburg, Beschluss vom 31.05.2002 - 203-VgK-09/2002
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0476
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Lüneburg, Beschluss vom 20.08.2002 - 203-VgK-12/2002
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0472
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Baden-Württemberg, Beschluss vom 15.07.2002 - 1 VK 35/02
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0471
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Baden-Württemberg, Beschluss vom 08.07.2002 - 1 VK 30/02
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0470
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Lüneburg, Beschluss vom 21.10.2004 - 203-VgK-47/2004
1. Schreibt die Auftraggeberin das streitbefangene Los - ohne hierzu verpflichtet zu sein - EU-weit im offenen Verfahren gemäß § 3a VOB/A aus und gibt als zuständige Nachprüfungsstelle die Vergabekammer bei der Bezirksregierung Lüneburg an, so legt die Auftraggeberin den rechtlichen Rahmen (§§ 102 ff. GWB) für die Nachprüfung fest.
2. "Kenntnis" im Sinne des § 107 Abs. 3 Satz 1 GWB ist gegeben, wenn ein Bieter aufgrund einer Festlegung in den Verdingungsunterlagen - ohne dies rechtlich fundiert begründen zu können - von einem Vergabefehler ausgeht.
3. Ist der Nachweis der Gleichwertigkeit durch Fabrikatangabe, Artikelnummer, Prospekte, Muster o. ä. zu erbringen und weicht der Bieter von den ausgeschriebenen Geräten ab und nennt lediglich die Gerätetypen ohne jegliche Beschreibung, so wird die Gleichwertigkeit dieser Geräte mit den ausgeschriebenen Geräten nicht nachgewiesen. Das Angebot ist auszuschließen. Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet, eigene Nachforschungen zur Gleichwertigkeit des Angebots anzustellen.
4. Auch eine fehlende Preisangabe führt zum Ausschluss des Angebotes.
5. Die Kostenentscheidung hinsichtlich der Erstattungsfähigkeit der Kosten der Beigeladenen folgt aus analoger Anwendung des § 162 Abs. 3 VwGO. Dort ist für das verwaltungsgerichtliche Verfahren geregelt, dass die außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen nur erstattungsfähig sind, wenn sie das Gericht aus Billigkeit der unterliegenden Partei oder der Staatskasse auferlegt. Die analoge Anwendung dieser Vorschrift zugunsten eines obsiegenden Beigeladenen ist im Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer geboten.
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0466
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Sachsen, Beschluss vom 20.08.2004 - 1/SVK/067-04
1. Die Beweislast für das Vorliegen von Ausnahmetatbeständen für das Abweichen vom Offenen Verfahren liegt beim Auftraggeber (arg. ex § 3 a Nr. 3 VOL/A. "Es ist aktenkundig zu machen, weshalb von einem Offenen Verfahren oder Nichtoffenen Verfahren abgewichen worden ist.")*)
2. Hat der Auftraggeber in der Vergabeakte/Vergabevermerk demgegenüber nicht dokumentiert, warum er vom Vorrang des Offenen Verfahrens gemäß § 101 Abs. 5 GWB abweichen darf, ist ein gegen die Durchführung eines Nichtoffenen Verfahrens gerichteter Nachprüfungsantrag grundsätzlich - bei unterstellter individueller Rechtsverletzung im übrigen - schon aus diesem Grund begründet (wie OLG Naumburg, B. v. 10.11.2003, 1 Verg 14/03).*)
3. Im Rahmen des § 3 a Nr. 1 Abs. 1 S. 1 i. V. m. § 3 Nr. 3 lit. b VOL/A muss der Auftraggeber eine - vorherige - Prognose anstellen, welchen konkreten Aufwand ein Offenes Verfahren bei ihm, aber auch der noch unbekannten Anzahl potenzieller Bieter voraussichtlich verursachen würde. Dabei hat er auf der Grundlage benötigter Verdingungsunterlagen den Kalkulationsaufwand eines durchschnittlichen Bieters für die Erstellung und Übersendung der Angebote und dessen sonstige Kosten zu schätzen. Zum Teil kann der Auftraggeber auch auf Erfahrungswerte parallel gelagerter Ausschreibungen oder auf eigene Schätzungen in Fällen der möglichen Überschreitung der EU-Schwellenwerte zurück greifen. Diese ermittelten Schätzkosten sind danach in ein Verhältnis zu dem beim Auftraggeber durch das Offene Verfahren erreichbaren Vorteil oder alternativ den Wert der Leistung zu setzen.*)
4. Bei der Ermittlung des Aufwands ist auch im Gegenzug einzustellen, welche Fixkosten der Auftraggeber im Nichtoffenen Verfahren als Sowieso-Kosten (z. B: Auswertungskosten und Kosten für vorgezogenen Teilnahmewettbewerb) hat und welche Refinanzierungsposten (z. B. nach § 20 VOL/A für die Kosten der Vervielfältigung der Verdingungsunterlagen) den zusätzlichen Aufwand beim Offenen Verfahren andererseits wiederum gegenüber dem Nichtoffenen Verfahren schmälern.*)
5. Der klare Wortlaut des § 3 Nr. 3 lit. b VOL/A verdeutlicht, dass ein für sich gesehen hoher Aufwand für die Durchführung eines Offenen Verfahrens unerheblich ist. Vielmehr muss der Auftraggeber zum einen den ermittelten Aufwand - in der ersten Variante - zu dem positiv erreichbaren Vorteil eines Offenen Verfahrens ins Verhältnis setzen. Selbiges gilt - wertneutral - zum alternativ relevanten Wert der Leistung bei Variante zwei. Erst wenn zumindest zu einer der beiden Bezugsgrößen zweifelsfrei ein Missverhältnis fest gestellt würde, darf das Nichtoffene Verfahren angewandt werden. Dabei geht die Vergabekammer - gestützt auf Berichte der Rechnungshöfe und auch auf eine sachverständige Wirtschaftlichkeitsbetrachtung - grundsätzlich davon aus, dass - aufgrund auch mathematischer Wahrscheinlichkeit - das wirtschaftlichste Angebot bei z. B. 50 fiktiven Angeboten im Offenen Verfahren preislich niedriger liegt als bei lediglich zehn Angeboten, zumal wenn diese - wie vorliegend - ausgelost werden.*)
6. Ein Missverhältnis im Sinne des § 3 Nr. 3 lit. b VOL/A liegt erst dann vor, wenn der zusätzliche Aufwand eines Offenen Verfahrens den ermittelten Vorteil um ein Vielfaches übersteigt.*)
7. Selbiges gilt für ein Missverhältnis zum Wert der Leistung. Nur dann, wenn der - zusätzliche - Aufwand eines Offenen Verfahrens einen Großteil des Wertumfangs der Leistung ausmacht, ist ein Nichtoffenes Verfahren gerechtfertigt. Bei der erforderlichen Individualbetrachtung steht ein immer höherer Wert der Leistung proportional zum Aufwand des Offenen Verfahrens. Je höher der betroffene Wert der Leistung, um so weniger wahrscheinlich kann der Aufwand des Offenen Verfahrens zu einem beachtlichen Missverhältnis führen. Ein anerkennenswerter Zusatzaufwand des Offenen Verfahrens von einem Prozent des Leistungswertes steht nicht im Missverhältnis zum Leistungswert.*)
8. Bei dieser Gesamtbetrachtung muss insbesondere der Ausnahmecharakter des Nichtoffenen Verfahrens gegenüber dem Offenen Verfahren berücksichtigt werden. Würde der Auftraggeber anhand nur von ihm vorgenommener und ungesicherter Prognosewerte zum Aufwand eines Offenen Verfahrens und geschätzter fiktiver Kosten einer noch ungewissen Anzahl von Bietern in jenem Offenen Verfahren generell das Nichtoffene Verfahren anwenden, wäre dem Haus- und Hoflieferantentum Tür und Tor geöffnet. Dies gilt um so mehr als der wettbewerbliche Aspekt der Beschaffungen durch § 97 Abs. 1 GWB gegenüber dem unterhalb der EU-Schwellenwerte allein dominierenden haushaltsrechtlichem Aspekt an Bedeutung gewonnen hat.*)
9. Es fehlt einem Bewerber die gemäß § 114 Abs. 1 GWB erforderliche Rechtsverletzung durch die fehlerhafte Durchführung eines lediglich Nichtoffenen Verfahrens, wenn er für ein separates Teillos im Gegensatz zu anderen Losen vom Auftraggeber singulär zur Angebotsabgabe aufgefordert wurde.*)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0457
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17.05.2004 - Verg 72/03
Bei einem objektiv unterdurchschnittlichen rechtlichen Schwierigkeitsgrad des Vergabenachprüfungsverfahrens sind nur Mittelgebühren als billig anzusehen.
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0455
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Schleswig-Holstein, Beschluss vom 03.11.2004 - VK-SH 28/04
1. Wohnungsbaugesellschaften fallen unter das Tatbestandsmerkmal der Erfüllung im Allgemeininteresse liegender Aufgaben nichtgewerblicher Art i.S.v. § 98 Nr. 2 GWB, wenn sie nach ihrer Satzung an einer dauerhaften und sozialen Wohnraumversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung mitwirken.*)
2. Für die Wertbarkeit von Nebenangeboten kommt es nicht darauf an, dass der Auftraggeber in den Verdingungsunterlagen hierfür technische Mindestbedingungen festgesetzt hat.*)
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0453
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Lüneburg, Beschluss vom 04.09.2003 - 203-VgK-16/2003
1. Der öffentliche Auftraggeber, der Entsorgungsleistungen ausschreibt, ist gehalten, von Prognosen hinsichtlich der Entwicklung der Abfallmenge nur zurückhaltend Gebrauch zu machen und den Bietern in erster Linie die Zahlen an die Hand zu geben, die dem Auftraggeber insbesondere hinsichtlich der jüngsten Entwicklung der für die Kalkulation maßgeblichen Fakten wie Abfallmenge, Behälter, Anzahl und Behältergröße etc. im Zeitpunkt der Abfassung der Verdingungsunterlagen aktuell bekannten und vorliegenden Zahlen mitzuteilen.
2. Von einer Pflicht zur Aufhebung der Ausschreibung als einzig rechtmäßige Maßnahme ist ausnahmsweise auszugehen, wenn eine wettbewerblich und wirtschaftlich fundierte Vergabe nicht mehr möglich ist, sinnlos wäre oder aber Bieter einseitig und schwerwiegend beeinträchtigen würden.
3. Dies kann etwa in den Fällen vorkommen, in denen irreparable Mängel der Leistungsbeschreibung vorliegen, sofern diese erheblich sind. In diesen Fällen kann einem Bieter ein vergaberechtlicher Anspruch auf Aufhebung des Vergabeverfahrens erwachsen, um so die Chance zu erhalten, in einem sich anschließenden, neuen Vergabeverfahren ein Angebot zu einem konkurrenzfähigen Preis anzubieten.
4. Die Antragsbefugnis für ein auf Aufhebung eines Vergabeverfahrens gerichtetes Nachprüfungsverfahren kann einem Antragsteller auch dann nicht abgesprochen werden, wenn er schlüssig vorträgt, warum seiner Auffassung nach im konkreten Fall das dem öffentlichen Auftraggeber durch § 26 VOL/A eingeräumte Ermessen ausnahmsweise zu Gunsten einer Aufhebung auf Null reduziert ist.
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0452
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Lüneburg, Beschluss vom 12.08.2003 - 203-VgK-15/2003
1. Ein Eigenanteil von 50 % bildet einen tauglichen Orientierungswert, um zu definieren, wann ein Bieter die Leistungen im Sinne des § 4 Nr. 8 Abs. 1 VOB/B im eigenen Betrieb ausführt.
2. gibt ein Bieter in Bezug auf den Eigenanteil an den ausgeschriebenen Leistungen dadurch ein widersprüchliches Angebot ab, dass er nach den mit dem Angebot eingereichten Angaben zur Preisermittlung (Vordruck EFB-Preis 1 b) den weit überwiegenden Anteil der Leistungen als Subunternehmerleistung angeboten hat, während er im Angebotsschreiben ausdrücklich erklärt, dass er für Leistungen, auf die sein Betrieb eingerichtet ist, die Leistung im eigenen Betrieb ausführen wird und hinsichtlich von Leistungen, auf die sein Betrieb nicht eingerichtet ist, keine Angaben macht, ist das Angebot zwingend auszuschließen.
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0449
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Lüneburg, Beschluss vom 04.07.2003 - 203-VgK-11/2003
1. Während der öffentliche Auftraggeber bei der Prüfung der Angebote gemäß gehalten ist, bei widersprüchlichen Angaben zwischen Gesamtbetrag und Einheitspreis anhand des Einheitspreises den korrekten Preis zu ermitteln und ggf. aus Billigkeitsgründen sogar verpflichtet sein kann, Einheitspreise, die in offensichtlichem Missverhältnis zu der verlangten Leistung stehen, in einem Aufklärungsgespräch mit dem Bieter aufzuklären, ist dies bei einem Pauschalangebot weder geboten noch gestattet.
2. Selbst der Bieter, der irrtümlich eine von ihm rechnerisch z.B. aus unrichtigen Einzelpreisen ermittelte Pauschalsumme offeriert, ist an sie gebunden.
3. Weicht ein Bieter von einem verbindlichen Terminplan ab, ist das Nebenangebot nicht gleichwertig.
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0448
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Sachsen, Beschluss vom 13.05.2003 - 1/SVK/038-03
1. Angehängte Stundenlohnarbeiten dürfen entsprechend § 9 Nr. 1 Satz 3 VOB/A nur in dem unbedingt erforderlichen Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden.*)
2. Angehängte Stundenlohnarbeiten dürfen bei der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes (§ 25 Nr. 3 Abs. 3 VOB/A) - auch und gerade, wenn sie als Bedarfsposition gekennzeichnet sind - nur dann gewertet werden, wenn der Auftraggeber dies vorher in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen verlautbart hatte und ein Wissenszuwachs hinsichtlich der Inanspruchnahme dieser Position besteht. Bloße Vermutungen reichen nicht.*)
3. Bei einer Ermessensreduzierung auf Null bei der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes kann die Vergabekammer den Auftraggeber - ausnahmsweise - nach § 114 Abs. 1 GWB verpflichten, dem Antragsteller den Zuschlag zu erteilen.
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0447
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Sachsen, Beschluss vom 03.07.2003 - 1/SVK/067-03
1. Es stellt eine unzulässige Nachverhandlung nach § 24 Nr. 3 VOB/A dar, wenn der Auftraggeber vom Bieter in einzelnen Leistungspositionen wie auch in der Gesamtangebotssumme als Additionssummen eingetragene Preispositionen als Minderpreise (mit negativen Vorzeichen) abzieht und der Bieter dadurch das wirtschaftlichste Angebot abgeben würde. Dies gilt auch dann, wenn diese Positionen als Minderposten im Ursprungsleistungsverzeichnis bezeichnet waren, vom Bieter jedoch zu den anderen Positionspreisen hinzuaddiert worden waren.*)
2. Einheitspreise dürfen vom Auftraggeber auch im Rahmen der rechnerischen Prüfung nach § 23 Nr. 2 und Nr. 3 Abs. 1 VOB/A nicht abgeändert werden.*)
3. Das Fehlen der geforderten "Aufgliederung wichtiger Einheitspreise" stellt keinen zwingenden Ausschlussgrund nach § 25 Nr. 1 Abs. 1 b i. V. m. § 21 Nr. 1 Abs. 1 S. 3 VOB/A dar. Diese fehlenden Angaben haben weder einen Einfluss auf den Angebotspreis noch wird durch ihr Fehlen der Angebotsinhalt zweifelhaft.
 Volltext
Volltext
VPRRS 2004, 0446
 Bau & Immobilien
Bau & Immobilien
VK Sachsen, Beschluss vom 12.06.2003 - 1/SVK/054-03
1. Eine Rüge nach § 107 Abs. 3 S. 1 GWB kann auch bei einem vom Auftraggeber eingeschalteten Ingenieurbüro erfolgen, wenn dessen bisherige Handlungen dem Auftraggeber zuzurechnen waren. Dies ist der Fall, wenn das Ingenieurbüro im Außenverhältnis zu den Bietern nahezu allein aufgetreten ist (LV-Anfragen, Federführung beim Bietergespräch bei diesem, Fertigung des Absageschreibens nach § 13 VgV auf Kopfbogen des Ingenieurbüros).*)
2. Ein Zuschlag ist nicht gemäß § 114 Abs. 2 S. 1 GWB wirksam erteilt, wenn es noch der Zustimmung zu Änderungen des Vertrages bedarf. Eine Annahme des Angebots unter Erweiterungen, Einschränkungen und sonstigen Änderungen gilt nach § 150 Abs. 2 BGB als Ablehnung, verbunden mit einem neuen Antrag. Dieser Antrag des Auftraggebers auf Abschluss eines abgeänderten Vertrages bedarf zu seiner Wirksamkeit deshalb noch einer Annahmeerklärung des Bieters, die dem Auftraggeber auch noch zugehen muss.*)
3. Bei der Wertung von Nebenangeboten nach § 25 Nr. 5 VOB/A muss sich der Auftraggeber ein klares Bild von der vorgesehenen Ausführung der Leistung machen können. Dabei ist auf dessen Empfängerhorizont abzustellen. Aus einem Nebenangebot muss klar hervor gehen, anstelle welcher Hauptleistungspositionen es treten soll und inwieweit. Eine Wertung eines Nebenangebotes kommt nicht in Betracht, wenn der Auftraggeber gezwungen ist, den Angebotspreis selber zu ermitteln. Die Vergleichsrechnung kann der Bieter nicht auf den Auftraggeber abwälzen, insbesondere wenn etliche LV-Positionen in unterschiedlichen Leistungstiteln betroffen sind.*)
4. Es führt zum Ausschluss von Haupt- und Nebenangeboten nach § 25 Nr. 1 Abs. 1 b) VOB/A i. V. m. § 21 Nr. 1 Abs. 1 S. 3 VOB/A, wenn ein zwingend mit Angebotsabgabe geforderter aktueller Nachweis der Gültigkeit einer Haftpflichtversicherung vom Bieter nicht geführt wird.*)
5. Die Vorlage einer schon mit Angebotsabgabe vorzulegenden und trotz erstmaliger Fristsetzung nicht in der geforderten Weise vorgelegten Bescheinigung erst im Vergabenachprüfungsverfahren ist auch angesichts der Regelung des § 24 Nr. 2 VOB/A nicht mehr relevant.*)
 Volltext
Volltext