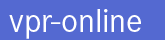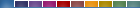Vergabepraxis & -recht.
IBR 2/2026 - Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,
im Bauvertragsrecht finden die Vorschriften der §§ 650b ff. BGB nur Anwendung, wenn es sich bei dem zwischen den Parteien geschlossenen Vertrag um einen Bauvertrag i.S.v. § 650a BGB handelt. Ein Bauvertrag ist nach § 650a Abs. 1 Satz 1 BGB ein Vertrag über die Herstellung, die Wiederherstellung, die Beseitigung oder den Umbau eines Bauwerks, einer Außenanlage oder eines Teils davon. Ein Vertrag über die Instandhaltung eines Bauwerks ist nach § 650a Abs. 2 BGB nur dann ein Bauvertrag, wenn das Werk für die Konstruktion, den Bestand oder den bestimmungsgemäßen Gebrauch von wesentlicher Bedeutung ist. Für die Praxis wichtig für die Abgrenzung zwischen einem Bauvertrag i.S.v. § 650a BGB und einem sog. Werkvertrag mit Bauwerksbezug sind insbesondere die Vorschriften des § 650e BGB (Sicherungshypothek des Bauunternehmers), des § 650f BGB (Bauhandwerkersicherung) und des § 650h BGB (Schriftform der Kündigung). Die gesetzgeberisch völlig missratene Vorschrift des § 650b BGB zu den Anordnungsrechten des Bestellers spielt demgegenüber im Baualltag keine Rolle, weil sie an der Baurealität und den Bedürfnissen der Baubeteiligten so weit vorbeigeht wie der Elfmeter von Uli Hoeneß am Tor im Finale der Fußball-Europameisterschaft 1976 vorbeiging. Der/die ein oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern …
Ungeachtet dessen gilt: „Als Jurist musst Du schauen, was Du aus dem Schrott machst, den der Gesetzgeber Dir hinterlassen hat.“ (frei nach Bernd Stromberg). Dementsprechend hatte sich der Bundesgerichtshof mit der Beantwortung der Frage zu befassen, ob es sich bei einem Vertrag über die Lieferung, Montage, Programmierung und Inbetriebnahme einer Sonnenschutzsteuerung für insgesamt 775 Jalousiemotoren inklusive Zentrale um einen Bauvertrag handelt. Der Besteller hatte sich gegenüber dem Sicherungsverlangen des Unternehmers aus § 650f BGB ohne Erfolg mit dem Argument verteidigt, der Vertrag sei kein Bauvertrag. Das Berufungsgericht war der Meinung, die Sonnenschutzsteuerung stelle selbst ein Bauwerk dar. Wenngleich es hierauf nicht entscheidungserheblich ankam, weist der Bundesgerichtshof in seinem Beschluss vom 17.12.2025 darauf hin, dass die Verpflichtung zur Lieferung, Montage und Programmierung einer Sonnenschutzsteueranlage die Herstellung eines Teils eines Bauwerks i.S.d. § 650a Abs. 1 Satz 1 BGB zum Gegenstand hat und aus diesem Grund ein Bauvertrag vorliegt ( S. 59).
S. 59).
Hinzuweisen ist zudem auf das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 13.11.2025 zum vermeintlichen Ausschluss eines mangelbedingten Schadensersatzanspruchs für Folgeschäden wegen eines weit überwiegenden Mitverschuldens des Bestellers. Es ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass z.B. dem Hauptunternehmer im Einzelfall ein mitwirkendes Verschulden zur Last fallen kann, wenn er einen Nachunternehmer nicht auf die Gefahr eines für den Nachunternehmer ungewöhnlich hohen Schadens wegen einer auf den Hauptunternehmer bei Vertragsausführung zukommenden Vertragsstrafe aufmerksam gemacht hat (BGH, Urteil vom 18.12.1997 – VII ZR 342/96, IBRRS 1998, 0822). Der Bundesgerichtshof nutzt die Gelegenheit, zu den Voraussetzungen der Annahme eines Mitverschuldens in derartigen Fällen Stellung zu nehmen: Das Mitverschulden nach § 254 Abs. 2 Satz 1 BGB setzt voraus, dass der Geschädigte es unterlassen hat, den Schädiger auf die Gefahr eines ungewöhnlich hohen Schadens aufmerksam zu machen, den dieser weder kennt noch kennen muss, oder dass er es unterlassen hat, den Schaden zu mindern. Zur ungewöhnlichen Höhe des Schadens sind Feststellungen zu treffen. Die Warnobliegenheit setzt ferner voraus, dass der Geschädigte die drohende Gefahr rechtzeitig erkannt hat oder hätte erkennen müssen, während der Schädiger die Gefahr weder gekannt hat noch kennen musste. Zudem ist ein Verstoß gegen die Warnobliegenheit für den Schaden nur ursächlich, wenn der Schädiger in der Lage war, Gegenmaßnahmen zu ergreifen ( S. 64).
S. 64).
Im Recht der Architekten und Ingenieure beschäftigt die Baukostenobergrenze regelmäßig Praxis und Rechtsprechung. Vereinbaren die Vertragsparteien bei Vertragsschluss oder im Laufe der Planung eine Baukostenobergrenze, liegt darin eine Beschaffenheitsvereinbarung. Die Planungsleistung entspricht nicht der vereinbarten Beschaffenheit, wenn sie ein Bauwerk vorsieht, dessen Errichtung höhere Herstellungskosten erfordert als vereinbart - das Architektenwerk erweist sich dann als mangelhaft (BGH,  IBR 2019, 500). Akzeptiert der Planer eine vertragliche Baukostenobergrenze, die von Anfang an nicht einhaltbar ist, dann können die Rechtsfolgen noch weiter reichen, wie eine aktuelle Entscheidung des OLG Bamberg zeigt: Der Architekt verspricht eine unmögliche Leistung (§ 275 Abs. 1 BGB) und kann deshalb für (nutzlos) erbrachte Planungsleistungen keine Vergütung verlangen (§ 326 Abs. 1 Satz 1 BGB) – und muss etwaig erhaltene Abschlagszahlungen zurückgewähren (
IBR 2019, 500). Akzeptiert der Planer eine vertragliche Baukostenobergrenze, die von Anfang an nicht einhaltbar ist, dann können die Rechtsfolgen noch weiter reichen, wie eine aktuelle Entscheidung des OLG Bamberg zeigt: Der Architekt verspricht eine unmögliche Leistung (§ 275 Abs. 1 BGB) und kann deshalb für (nutzlos) erbrachte Planungsleistungen keine Vergütung verlangen (§ 326 Abs. 1 Satz 1 BGB) – und muss etwaig erhaltene Abschlagszahlungen zurückgewähren ( S. 77). Im entschiedenen Fall waren die in der Kostenschätzung in Leistungsphase 2 ermittelten 13,5 Mio. Euro gegenüber den als Baukostenobergrenze vereinbarten „ca.“ 4,2 Mio. Euro letztlich zu viel des Guten.
S. 77). Im entschiedenen Fall waren die in der Kostenschätzung in Leistungsphase 2 ermittelten 13,5 Mio. Euro gegenüber den als Baukostenobergrenze vereinbarten „ca.“ 4,2 Mio. Euro letztlich zu viel des Guten.
Im Vergaberecht dienen Planungswettbewerbe dem Ziel, alternative Vorschläge für Planungen auf der Grundlage veröffentlichter einheitlicher Richtlinien zu erhalten (§ 78 Abs. 2 VgV). Dazu gehört insbesondere die Richtlinie für Planungswettbewerbe i.d.F. vom 31.03.20213 (RPW 2013), die über entsprechende Erlasse praktisch flächendeckend eingeführt ist. Nach § 5 Abs. 1 RPW 2013 beschreibt der Auslober in der Auslobung die Aufgabe und die Wettbewerbsbedingungen klar und eindeutig. Er definiert die Anforderungen und die Zielvorstellungen, benennt seine Anregungen und legt fest, ob und gegebenenfalls welche als bindend bezeichneten Vorgaben es gibt, deren Nichteinhaltung zum Ausschluss führt. Aufgrund des Wortlauts der Regelung sind nur solche Vorgaben bindend, die der Auslober ausdrücklich als bindend bezeichnet hat. Die fehlende Bezeichnung von Vorgaben als „bindend“ führt dazu, dass diese keinen verbindlichen Charakter mit Ausschlusswirkung aufweisen. Das betont das OLG Jena in seinem Beschluss vom 19.11.2025 ( S. 84).
S. 84).
Auch alle anderen Beiträge empfehlen wir Ihrer Aufmerksamkeit.
Mit den besten Grüßen
Dr. Stephan Bolz
Rechtsanwalt
Geschäftsführender Herausgeber der IBR
Thomas Ryll
Rechtsanwalt
Schriftleiter der IBR